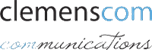Caspar van Meel
Gespräch mit dem aus den Niederlanden stammenden Kontrabassisten

Du hast gleich zwei Abschlüsse. Einer davon ist in Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Philosophie. Was hat dich an diesem Studium fasziniert? Mit welchem Philosophen hast du dich besonders befasst?
Caspar van Meel: Mein ursprüngliches Ziel, mein Traum war es Journalist zu werden. Journalistik eher im kulturellen Sinne. Ich wollte keinen Tagesblatt-Job haben. Mein Ziel war es, für Magazine zu schreiben, die etwas tiefgründiger gehen. Ich habe dann ein Praktikum beim Philosophie-Magazin gemacht. Das war also der ursprüngliche Plan. Und diesen konnte man gut an der Universität Maastricht umsetzen, weil man dort Kulturwissenschaften studieren konnte. Das ist ein sehr breit angelegter Studiengang. Dabei habe ich mich auf Philosophie spezialisiert. Ich habe darin auch meine Diplomarbeit geschrieben. Sie ging über Friedrich Nietzsche und Musik. Er war selber Komponist und der Titel meiner Arbeit lautete: „Der musizierende Sokrates“. Diese Arbeit bezieht sich auf „Die Geburt der Tragödie“. Musik spielt eine große Rolle für Nietzsche, und man kann die Rolle der Musik in seinem ganzen Werk ausmachen, bis „Ecce Homo“ und „Jenseits von Gut und Böse“. Musik steht auch als Metapher für Nietzsches Denken.
Wie war dann der Schritt nach einem theoretisch ausgerichteten Studium ein Musikstudium anzuschließen und zwar mit dem Schwerpunkt Kontrabass? Dieser ist ein sehr voluminöses Instrument und beim Reisen von Spielort zu Spielort eher hinderlich. Das Instrument hat außerdem trotz der Größe keine besonders große Resonanz, oder?
Caspar van Meel: Da muss ich zurückgehen auf meine ersten E-Bass-Stunden. Ich habe mit 15 angefangen, Bass-Gitarre zu erlernen. Ich hatte einen ganz großartigen Lehrer. Ich habe damals unter anderem Nirvana und die neuste Grunge-Musik gehört. Da komme ich eigentlich her. Innerhalb von ein, zwei Jahren hat mein Lehrer mir eine Welt eröffnet. Es ging von Frank Zappa bis Charlie Parker, Duke Ellington, Funk Music, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone – wirklich sehr breit gefächert. Und ich habe E-Bass angefangen zu lernen, weil ich Freunde hatte, die jemanden gesucht haben, der in einer Band Bass spielt. Drei Wochen lang habe ich Fenster geputzt, um das Geld für den Kauf eines E-Basses zu verdienen. Zwei Wochen später war ich dann in dieser Band. Es hat viel Spaß gemacht, und es hat auch miteinander gut geklappt.
Ich habe von Anfang an sehr viel geübt. Irgendwann bin ich in eine Bücherei gegangen, die auch CDs ausgeliehen hat. Auf einer der CDs war ein Herr abgebildet, der hieß Dave Holland. Den kannte ich nicht, aber ich habe ihn mir angehört. Die Platte hieß übrigens „Extensions“. Mit dieser Platte ging ich zu meinem Lehrer mit dem Vorsatz zu erlernen, was Holland eingespielt hatte. Ich weiß jetzt, dass eines der Stücke in einem 13/8-Takt und sehr komplex komponiert war. Ich hatte gerade ein Jahr lang Bass gespielt und wollte gerne so wie Holland spielen. „Gut und dann machen wir das.“, das war die Reaktion des Lehrers. Ich habe mich dann immer mehr in Jazz vertieft und weitergebildet. Charles Mingus war für mich ein großer Held, nicht nur als Bass-Spieler, sondern auch als Komponist und Bandleader. Er war sehr inspirierend für mich. Und dann war klar, ich muss eigentlich Kontrabass erlernen. Ich wollte ja diese Stilistik, sprich Jazz, spielen. So bin ich halt, um deine Frage zu beantworten, zum Kontrabass gekommen.
Neben dem Studium an der Uni in Maastricht habe ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Maastricht gemacht. Ich habe dann nicht nur Kulturwissenschaften, sondern auch Kontrabass studiert. Und eines Tages traf ich John Goldsby (Anm.: us-amerikanischer Kontrabassist) in einem Workshop. Er erzählte mir, dass er in Essen unterrichte. „Super, soweit ich den Uni-Abschluss in Maastricht habe, dann komme ich nach Essen.“, dachte und plante ich. Ich habe die Aufnahmeprüfung an der Folkwang Uni Essen bestanden. Danach habe ich bei John Goldsby weiter Kontrabass studiert.


Und wie hast du dich mit diesem Instrument anfreunden können?
Caspar van Meel: Es war Liebe auf den ersten Blick. Mein erster Lehrer, der hatte einen Kontrabass in seiner Wohnung stehen. Und darauf hat er das Intro von „Hatian Fight Song“ von Charles Mingus gespielt. Und nach Dodadodo – (Anm.: Caspar van Meel summte beim Interview die Melodie) –, dachte ich, das will ich auch. Ich bin eigentlich ein sehr unentschiedener Mensch, aber es gab in meinem Leben einige entscheidende Momente, der Moment, Mingus spielen zu können, und der Moment, als ich meine Frau gesehen habe und sie heiraten wollte.
Ist der Kontrabass nicht in Wirklichkeit unförmig und im Vergleich zu deinen Mitmusikern im Satie-Projekt als Instrument sehr unhandlich?
Caspar van Meel: Ja, es ist ein großes Instrument, aber dafür klingt es geil!
Hat der Bass alleine eigentlich Durchsetzungsstärke wie andere Instrumente, zum Beispiel Saxofon oder Trompete?
Caspar van Meel: Gezupft ist der Kontrabass ein eher leiseres Instrument; gestrichen dagegen kann er auch lauter werden. Im Jazz-Kontext ist es eines der leisesten Instrumente. Man kann den Bass schon akustisch spielen, aber je größer die Band wird, je mehr man Kompromisse eingehen muss, auch bezogen auf die Geschwindigkeit, dann ist das schon eine technische Herausforderung für einen Bassisten.
Welche Rolle spielt John Goldsby für dich? Und welche anderen Bassisten haben für dich als Vorbild eine Rolle gespielt?
Caspar van Meel: Dave Holland habe ich ja schon erwähnt und auch Charles Mingus. Ich bin vor allem von Kontrabassisten fasziniert, die auch gute Bandleader und Komponisten waren. Mein Streben ist, „nicht nur Bass zu spielen“, sondern auch ein einheitliches Konzept auf die Bühne zu bringen. Dafür sind Holland und Mingus gute Beispiele. Außerdem zu nennen sind Larry Grenadier, Oscar Pettiford, Paul Chambers, Ray Brown – besonders die drei Erstgenannten fand ich neben Mingus besonders gut. Ja, von „der neuen Generation“ ist Christian McBride zu nennen.
Lass uns über deine Veröffentlichungen reden, zunächst über „On the Edge". Wie würdest du dieses Album kurz und knapp beschreiben?
Caspar van Meel: Bei diesem Album ging es ganz klar um meine eigenen Kompositionen. Den Titel habe ich aus zwei Gründen gewählt: Einerseits ist es das erste Stück der Platte, andererseits ist es ein politischer Grund gewesen. Die Platte wurde 2020 veröffentlicht. Aus meiner Sicht befinden wir uns als Gesellschaft an einer Bruchstelle. Ich bin aufgewachsen in den 1990er Jahren, als ein sehr neoliberales, pragmatisches Denken herrschte. Die Idee war, der Kapitalismus und die Demokratie werden in der Welt siegen. Es gab ein Buch „Ende der Geschichte“ von Francis Fukuyama mit ähnlicher Aussage. Es hat sich herausgestellt, das dieses „Ideal“ nicht aufgeht. Und wir leben nun in einer Welt, in der Polarisierungen zwischen Rechts und Links eher zunehmen, statt dies aufzulösen. Darauf zielt der Titel ab, aber auch einige Kompositionen beziehen sich darauf.
Dann gibt es ja noch das Album „Satie – A Time Remembered“. Warum hast du gerade die Kompositionen von Erik Satie als Ausgangspunkt gewählt? Wieso er und nicht ein anderer Komponist wie Chopin oder Messiaën zum Beispiel?
Caspar van Meel: Beide von dir Genannten sind weit entfernt von Erik Satie. Die Beschäftigung mit Satie war auch eine emotionale Entscheidung. Die Musik habe ich als Heranwachsender kennen gelernt, mit 20/21. Ich habe damals unter anderem die „Gnossienne No 3“ auf der Gitarre gespielt. Diese Musik hat mich sehr berührt. Die Musik hat eine bestimmte melancholische Art, die mich damals angesprochen hat und es noch immer tut.
Im Studium habe ich die „Gymnopédie No 1“ auf dem Klavier geübt. Und zugleich habe ich angefangen, über das Stück zu improvisieren. Das hat mir Spaß gemacht. Daraus ergab sich, dass ich für eine kleinere Besetzung ein Arrangement geschrieben habe. Die Melodien von Satie sind im Kern sehr einfach und eignen sich deshalb sehr gut für eine Bearbeitung. Dann habe ich mir weitere Stücke angeschaut, so „Gnossienne no 3“.
Während ich das gespielt habe, kam mir das Arrangement für Bläser in den Sinn. Oft spiele ich etwas am Klavier und habe zugleich die Vorstellung, welche Instrumente dazu passen. Das ist rein intuitiv. Ich habe das gleichsam innerlich so gehört, diese Art, es so zu arrangieren. Es gab noch einen weiteren Aspekt, der für das Projekt maßgeblich war: Im Studium habe ich mich mit bestimmten Harmonien auseinandergesetzt, vor allem in Kooperation mit Peter Herborn (Anm. Mitbegründer des Bereichs Jazz an der Folkwang Hochschule Essen, Posaunist, Bandleader, Komponist und Arrangeur). Mit ihm habe ich eine Platte aufgenommen namens „Forgotten Chords“. Die Band hieß übrigens Question Quartet.
Es waren Harmonien, die selten benutzt werden. Die kommen im Jazz schon vor, aber nicht sehr oft. Herborn hat das System systematisiert. Die Akkorde die wir im Jazz spielen, sind abgeleitet von Harmonisch-Dur, aber meist nur die fünfte Stufe, und Harmonisch-Moll, vielleicht die dritte Stufe oder die Erste oder auch Siebte. Die anderen Stufen werden außen vor gelassen. Diese Akkorde zu nutzen, war sehr ansprechend. Diese Platte und auch das Buch heißen nicht umsonst „Forgotten Chords“. Es sind schon Akkorde, die genutzt, aber vergessen worden sind. Im Jazz werden sie oft ignoriert. Satie ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der nutzt Tonleitern in seinen Melodien, dabei Skalen nutzend, die im Jazz selten sind, so durisch B5. Bei Satie findest du diese Leitern in den Melodien, aber in der linken Hand findest du einfache Dreiklänge. Er hat es sehr versöhnend eingebettet. Es ist gerade interessant, die Melodietöne auch in die Akkorde zu legen. Diese Dissonanzen, die alle vorhanden sind, weiter „herauszukitzeln“, darum ging es mir. Satie aufzuklappen, aufzufächern, groß zu machen, das war und ist meine Intention mit dem Projekt. Ich habe die Stücke am Klavier gespielt und zugleich in meinem Kopf die Instrumentierungen gehört. Ich fand sehr interessant, die Harmonien, die ich auf dem Klavier gespielt habe, in den Bläsersatz zu transportieren. Ich habe immer darauf geachtet, den ursprünglichen Gestus, die Stimmungen der Werke und deren Ideen zu erhalten. Ich finde, dass mir das gelungen ist, auch wenn man nicht unbedingt den Minimalismus findet, der bei Satie vorhanden ist.
Satie hat ja immer wiederkehrende Motive verwendet, oder? Er hat ja auch stets bei den Stücken genaue Anweisungen niedergeschrieben. Satie hat seine Werke mit sehr genauen Angaben zum Duktus versehen, z. B. „Lent et douloureux“, Lent et triste“ sowie „Lent et grave“. Und es finden sich weitere Kommentierungen von Satie u.a.: „Unappetitliche Choral“ – „Choral inapétissant“ – hingewiesen, den Satie 1914 „den Verschrumpelten und Verblödeten“ widmete. Schließlich sei noch „Wahrhaft schlaffe Präludien für einen Hund“ (Véritables Préludes flasques pour un chien) erwähnt. Welche Relevanz hatte das für deine Arrangements?
Caspar van Meel: Ich zeige dir mal die Bass-Stimme für die zweite „Gnossienne“, die ich geschrieben habe. Dann siehst du hier: „mit Erstaunen“, „Komm nicht raus“, „Mit großer Güte“, „leicht und intim“. Wenn man diese Kommentare liest, kann man die ernst nehmen, aber Satie war ja ein witziger Mensch, ein ironischer Mensch. Eigentlich sind die Kommentare selbst eine ironische Anspielung auf andere Komponisten und deren Kommentare in ihren Kompositionen. Er macht ja zum Beispiel den ironischen Kommentar „Komm nicht raus“ im Sinne von „Musiker, verspiele dich bloß nicht“. Charakteristisch ist bei Satie auch die Abwesenheit von Takten. Mehrmals hat er versucht zu studieren. Das gelang ihm nicht. Satie war ein eigenartiger Mensch. Er war ein rebellischer Mensch. Er war ein problematischer, schwieriger Charakter. Ich habe die Kommentare gesehen und auch in die Partitur hineingeschrieben. Im Arbeitsprozess mit den Musikern entstehen dann auch andere Interpretationen. Es geht im Grunde darum, dass eine neue Interpretation entsteht, eine neue Musik, die einzigartig ist und die auch meine persönlichen Ideen von Jazz widerspiegelt. Ich hoffe, dass zwischen meiner ersten und meiner aktuellen Platte eine gewisse Kontinuität besteht, da ich ja zum Teil mit den gleichen Musikern arbeite und mit der gleichen Band. Ja, ich habe die Anmerkungen aufgenommen. So spielt bei „leicht und intim“ nur der Trompeter Ryan Carniaux. Ich habe auch ganz bewusst vom Klavier zum Bläsersatz hin arrangiert!
John Cage hat sich Saties „Vexations“ vorgenommen und das Thema mit zwei Variationen in einem Konzert von 18 Stunden und 40 Minuten aufgeführt. Das Stück gilt als ein frühes Werk serieller Musik. Das hast du nicht ins Projekt aufgenommen, ganz bewusst nicht aufgenommen?
Caspar van Meel: Nein, diese Satie Arbeit habe ich nicht arrangiert und auch nicht die „Parade“. Ich habe sehr viel weggelassen, da das Werk sehr breit ausgelegt ist. Die „Gnossiennes“ haben mich besonders angesprochen, schon in meiner Jugend. Das sind Arbeiten, die Satie zu einer Zeit geschrieben hat, als er sich als Barpianist verdingte. Diese Kompositionen spiegeln auch seine Haltung aus dieser Periode wider. Wenn man seine späteren Arbeiten betrachtet, dann ist das auch ein erwachsener Komponist, der viel ironischer wird und weniger Weltschmerz in seinen Kompositionen zum Ausdruck bringt. Die „Gnossiennes“ sind im übrigen gut arrangierbar für Jazz, unter anderem wegen der einfachen Melodien, die sich gut abändern lassen. Ich könnte mir durchaus auch Arrangements anderer Stücke vorstellen. Zum Beispiel hat der us-amerikanische Pianist und ehemalige Chefdirigent der WDR-Big_Band Michael Abene Satie für Big Band arrangiert. Das sind 140 Minuten Musik für große Bläsersätze. Das ist sehr, sehr breit ausgefächert, aber das war für mein Projekt gar nicht meine Absicht. Ich wollte Platz haben für Improvisation. Ich habe mich bewusst auf die „Gnossiennes“ beschränkt und wollte zudem auf der Platte ein Stück von Bill Evans haben, um die Parallelen zum Jazz deutlich zu machen. Bill Evans hat auch „Peace Piece“ aufgenommen, eine Impro wahrscheinlich n einem Studio, bei der er die Intro der „Gymnopaedie No“ 1 als Kadenz spielt. Nicht nur in diesem Stück wird der Einfluss von Satie deutlich, sondern auch in „Time Remembered“. Da findest du diese Moll-Akkorde und Major 7-Akkorde ohne eine Dominante. Das ist die Erneuerung von Satie, harmonisch gesehen. Diese Moll-Akkorde haben eine bestimmte Stimmung. Eigentlich ist das eine Art modaler Jazz. Was Evans nicht übernommen hat, ist die wahnsinnig spannende Skala von Satie.

Du hast dich in der Instrumentierung der Satie-Stücke nicht auf einen „Minimalismus“ – Solo-Bass oder Duo Bass und Posaune oder Klavier und Bass – beschränkt. Wieso nicht?
Caspar van Meel: Es ist mir schon durch den Kopf gegangen. Ich bin ja Musiker, Künstler, und spiele die Stücke am Klavier. Und ich habe dann gleich die Instrumentierung in der Vorstellung präsent. Ich habe die Stücke gehört und so wiedergegeben, wie ich sie als Musiker gehört habe. Das war mein Anliegen. Ich habe mich mit Satie auseinandergesetzt und Elemente übernommen. Ich konnte mir die Umsetzung der Harmonien nicht vorstellen mit Bass und zwei Bläsern oder Bass mit einem Bläser. Ich wollte kein Album à la Jacques Loussier machen. Wenn man zu sehr bei den Originalen bleibt oder in der originalen Instrumentierung bleibt, dann könnte das in eine Sackgasse führen. Satie gibt es in diversen Aufnahmen und auch eine Trio-Einspielung von Jacques Loussier. Weitere derartige Aufnahmen braucht man nicht.
Neben deinem eigenen Quintett spielst du auch mit Gero Köster und Barbara Barth im Ellington Trio mit Bezug auf den großen Meister des Swing-Jazz, Duke Ellington. Was ist die Herausforderung an ein solches Trio?
Caspar van Meel: Ich hatte ja schon berichtet, dass ich mir als Jugendlicher in den Plattenläden und in der Bibliothek CDs ausgeliehen habe. Eine davon war „Uptown“ von Duke Ellington. Das ist die erste Jazzplatte, die ich je gehört habe. Das sind großartige Kompositionen, die auch eine Herausforderung beinhalten. Es ist wahnsinnig spannend, sich mit dieser Musik zu befassen. Zusätzlich haben wir als Trio über die Jahre eine Interaktion und ein Zusammenspiel entwickelt, wie es nur entsteht, indem man viel zusammen spielt. Wir spielen zum Beispiel seit zehn Jahren „It don't mean a thing ...“. Wir haben dafür eine ganz eigene Interpretationsform gefunden.
Nun gibt es mit Jaggat eine weitere Trio-Band mit einer anderen Instrumentierung, nämlich Bass, Gitarre und Perkussion. Wie kam es zur Band und zur Instrumentierung? Wie würdest du die Band charakterisieren?
Caspar van Meel: Sie ist hervorgegangen aus der Zusammenarbeit mit Markus Conrad. Wir waren auch zusammen in dem Ensemble „Electric Smog“, in dem er E-Gitarre spielte und ich E-Bass. Zunächst haben wir dann mit einem Flötisten ein Trio geformt. Allerdings ist diese Zusammenarbeit auseinandergegangen. Wir haben uns dann entschieden, weiter als Duo zusammen zu spielen. Dann gab es die Idee, es wäre schön, noch einen Perkussionisten dazuzunehmen. Wir spielen Kompositionen von Markus und mir. Die Musik ist vielfältig, Latin, Jazz, Klassik, Musik des Vorderen Orients, Flamenco, Musik aus Afrika. Daher auch der Name Jaggat, „Welt“ in Sanskrit! Wir haben dann in Afra Mussawisade einen perfekten Partner gefunden, der auch ein einzigartiges Set-up spielt, mit Instrumenten aus aller Welt. Diese hat er selber zusammengebaut. In diesem Projekt zeige ich mich sehr stark als Instrumentalist, während ich mich in den anderen eher etwas zurücknehme.
Interview / Photos © Ferdinand Dupuis-Panther (fdp) 2025
Info
https://www.casparvanmeel.com/de/
https://www.ellingtontrio.com
https://casparvanmeel.com/de/als-co-leader/jaggat.html

Concert reviews
https://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/jaggat-über-alle-grenzen-hinweg/
https://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/treffpunkt-altstadtschmiede-das-caspar-van-meel-quintett/
https://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/jazzlive-caspar-van-meel-rethinking-erik-satie/
CD Review
https://www.jazzhalo.be/reviews/cdlpk7-reviews/c/caspar-van-meel-quintet-on-the-edge/
Other
In case you LIKE us, please click here:

Foto © Leentje Arnouts
"WAGON JAZZ"
cycle d’interviews réalisées
par Georges Tonla Briquet

our partners:



Hotel-Brasserie
Markt 2 - 8820 TORHOUT

Silvère Mansis
(10.9.1944 - 22.4.2018)
foto © Dirck Brysse

Rik Bevernage
(19.4.1954 - 6.3.2018)
foto © Stefe Jiroflée
Philippe Schoonbrood
(24.5.1957-30.5.2020)
foto © Dominique Houcmant

Claude Loxhay
(18.2.1947 – 2.11.2023)
foto © Marie Gilon
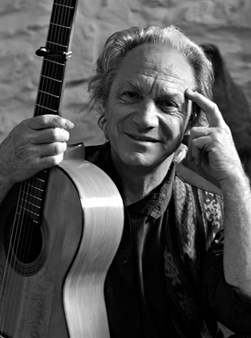
Pedro Soler
(8.6.1938 – 3.8.2024)
foto © Jacky Lepage

Sheila Jordan
(18.11.1928 – 11.8.2025)
foto © Jacky Lepage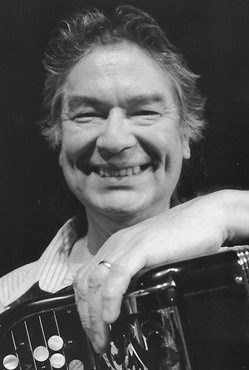
Raúl Barboza
(22.5.1938 - 27.8.2025)
foto © Jacky Lepage
Special thanks to our photographers:
Petra Beckers
Ron Beenen
Annie Boedt
Klaas Boelen
Henning Bolte
Serge Braem
Cedric Craps
Luca A. d'Agostino
Christian Deblanc
Philippe De Cleen
Paul De Cloedt
Cindy De Kuyper
Koen Deleu
Ferdinand Dupuis-Panther
Anne Fishburn
Federico Garcia
Jeroen Goddemaer
Robert Hansenne
Serge Heimlich
Dominique Houcmant
Stefe Jiroflée
Herman Klaassen
Philippe Klein
Jos L. Knaepen
Tom Leentjes
Hugo Lefèvre
Jacky Lepage
Olivier Lestoquoit
Eric Malfait
Simas Martinonis
Nina Contini Melis
Anne Panther
France Paquay
Francesca Patella
Quentin Perot
Jean-Jacques Pussiau
Arnold Reyngoudt
Jean Schoubs
Willy Schuyten
Frank Tafuri
Jean-Pierre Tillaert
Tom Vanbesien
Jef Vandebroek
Geert Vandepoele
Guy Van de Poel
Cees van de Ven
Donata van de Ven
Harry van Kesteren
Geert Vanoverschelde
Roger Vantilt
Patrick Van Vlerken
Marie-Anne Ver Eecke
Karine Vergauwen
Frank Verlinden
Jan Vernieuwe
Anders Vranken
Didier Wagner
and to our writers:
Mischa Andriessen
Robin Arends
Marleen Arnouts
Werner Barth
José Bedeur
Henning Bolte
Paul Braem
Erik Carrette
Danny De Bock
Denis Desassis
Pierre Dulieu
Ferdinand Dupuis-Panther
Federico Garcia
Paul Godderis
Stephen Godsall
Jean-Pierre Goffin
Claudy Jalet
Chris Joris
Bernard Lefèvre
Mathilde Löffler
Claude Loxhay
Ieva Pakalniškytė
Anne Panther
Etienne Payen
Quentin Perot
Jacques Prouvost
Jempi Samyn
Renato Sclaunich
Yves « JB » Tassin
Herman te Loo
Eric Therer
Georges Tonla Briquet
Henri Vandenberghe
Peter Van De Vijvere
Iwein Van Malderen
Jan Van Stichel
Olivier Verhelst